Der Schellenbaum
Seiner Herkunft nach
ist der Schellenbaum in den deutschen Heeren nicht als Instrument, sondern als
Siegestrophäe aufzufassen, die der Truppe bei besonderen Anlässen symbolhaft
als "Fahne der Musik" vorausgeführt wird. Er wurde daher auch nicht von
einem Hoboisten, sondern von einem Angehörigen der Truppe getragen.
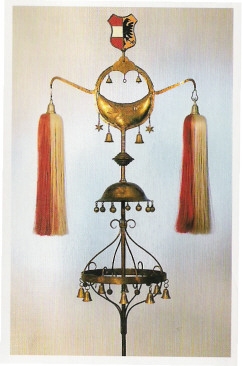
Der Ursprung des Schellenbaumes,
dessen Name bei uns von den zahlreich angehängten Schellen abgeleitet
ist, liegt vermutlich in China, im "Chinesischen Schellenhut" (franz.
chapeau chinois). Er ist über Indien nach Kleinasien gekommen und fand bei
den Türken in den Musikgruppen der Janitscharen Aufnahme. Mit den
Schlaginstrumenten – Trommel, Becken – und dem Triangel ( dem Vorläufer der
Lyra) wurde er durch rhythmisches Schütteln zur taktbestimmenden,
charakteristischen Begleitung der melodieführenden Blasinstrumente. Die
Janitscharenmusik, auch "Türkische Musik" genannt, gelangte im 18.
Jahrhundert mit den Türkenkriegen in fast alle europäischen Heere. Preußen
stellte eine derartige Musikbesetzung zuerst in seinem Artillerie - Regiment
zusammen (1740). Sie bestand aus 16 "Mohren".
Der Schellenbaum hat seine äußere
Wesensmerkmale erst in den türkischen Heerscharen erhalten. Neben dem
Halbmond sind es hauptsächlich die gefärbten Rossschweife, die seine
türkische Abstammung unterstreichen. Sie sind von den Feldzeichen hoher
militärischer Würdenträger übernommen worden. Deshalb ist der Schellenbaum
auch als Mohammedsfahne" bekannt. Die Engländer sprechen vom turkish
crescent (= türkischer Halbmond), der Soldatenmund machte daraus jingling
johnnie". Bei den genannten Feldzeichen hingen die Rossschweife von einem
Halbmond herab, der über einer gleichartigen Kugel an einem tragenden Stab
befestigt war. Diese Zeichen wurden den Befehlshabern vorangetragen oder vor
ihren Zelten aufgestellt.
 Die
Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan
standen sechs zu. Über die
Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:
"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige
Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der
General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu
helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,
ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:
"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken
fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den
Sieg." Der Schellenbaum wurde von
einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer
Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge
1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur
Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur
Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem
Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren
Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des
vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch
verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit
zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden
Bestimmungen vom 27.01.1902.
Die
Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan
standen sechs zu. Über die
Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:
"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige
Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der
General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu
helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,
ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:
"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken
fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den
Sieg." Der Schellenbaum wurde von
einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer
Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge
1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur
Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur
Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem
Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren
Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des
vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch
verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit
zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden
Bestimmungen vom 27.01.1902.
Letzte Aktualisierung:
06.01.10
Michael Pohl
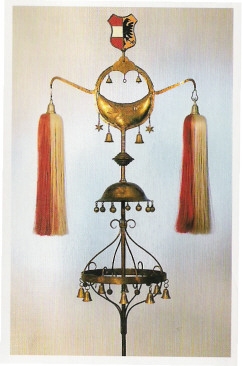
 Die
Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan
standen sechs zu. Über die
Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:
"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige
Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der
General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu
helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,
ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:
"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken
fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den
Sieg." Der Schellenbaum wurde von
einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer
Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge
1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur
Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur
Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem
Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren
Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des
vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch
verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit
zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden
Bestimmungen vom 27.01.1902.
Die
Zahl der Rossschweife war verschieden; dem Sultan
standen sechs zu. Über die
Entstehung der Rossschweife als türkische Abzeichen wird berichtet:
"In einem Treffen gegen die Christen verloren die Türken eine wichtige
Fahne und mit ihr den Mut. Alles ergriff in der größten Verwirrung die Flucht. Da der
General dies wahrnahm, wusste er sich nicht anders zu
helfen, als dass er einem Pferd mit seinem Säbel den Schweif abhieb,
ihn auf eine Pike heftete, sie emporhob und den Fliehenden zurief:
"Hier ist die große Standarte; wer mich liebt, der folge mir". Die Türken
fassten neuen Mut, schlossen sich wieder in feste Glieder, griffen den Feind herzhaft an und erkämpften den
Sieg." Der Schellenbaum wurde von
einzelnen preußischen Truppenteilen bei ihrer
Regimentsmusik erst eingeführt, nachdem sie einen solchen im Laufe der Feldzüge
1813 / 15 erobert oder erbeutet hatten. Als der König seine Erlaubnis zur
Führung erteilt hatte (nur für Infanterie und Fußartillerie), wurde es zur
Prestige- und Ehrensache, dergleichen Trophäen zu besitzen. Nach dem
Kriege waren es zuerst einzelne Stände, dann auch Städte, die den in ihren
Provinzen oder in ihren Mauern stehenden Regimentern als Zeichen des
vaterländischen Dankes solche "Siegeszeichen" stifteten. Um in der dadurch
verursachten Verschiedenartigkeit der Schellenbäume eine gewisse Gleichheit
zu erzielen, erließ Kaiser Wilhelm II. die für Neuanschaffungen geltenden
Bestimmungen vom 27.01.1902.